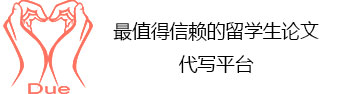服务承诺
 资金托管
资金托管
 原创保证
原创保证
 实力保障
实力保障
 24小时客服
24小时客服
 使命必达
使命必达
51Due提供Essay,Paper,Report,Assignment等学科作业的代写与辅导,同时涵盖Personal Statement,转学申请等留学文书代写。
 51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标 51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标 51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标 51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标私人订制你的未来职场 世界名企,高端行业岗位等 在新的起点上实现更高水平的发展
 积累工作经验
积累工作经验 多元化文化交流
多元化文化交流 专业实操技能
专业实操技能 建立人际资源圈
建立人际资源圈Praktikumsbericht_Alte_Ziegelei
2013-11-13 来源: 类别: 更多范文
Inhaltsangabe:
1. Der Betrieb
2. Spanende Fertigungsverfahren (GP1) vom 08.08.2005 bis 26.08.2005
-Feilen; Bohren; Gewindeschneiden; Sägen; Reiben
-Drehen und Fräsen
3. Thermische Füge- und Trennverfahren (GP3) vom 29.08.05.bis 09.09.2005
-MIG/MAG Schweißen
-Lichtbogenschweißen
4. Umformende Fertigungsverfahren (GP2) vom 12.09 bis 16.09.2005
- Biegen von Blechwinkeln, -Blechtafeln und Edestahlrohren
- Vernieten von Bauteilen
5. Montagen auf diversen Baustellen
1. Der Betrieb:
Der Metallbau Meisterbetrieb Meinert & Seifert ist ein Familienbetrieb mit ungefähr 15 Mitarbeitern und hat sich hauptsächlich der Fertigung von Tür- und Fensteranlagen, die je nach Kundenwunsch auch Brandschutzanforderungen erfüllen, verschrieben. Der Firmensitz inklusive der Produktionshalle ist im Münsterländischen Reken angesiedelt. Hier durfte ich während meines 6-wöchigen Praktikums Spandende Fertigungsverfahren, Thermische Füge- und Trennverfahren sowie Umformende Fertigungsverfahren kennenlernen und auf diversen Baustellen meine Fähigkeiten unter Beweis stellen.
2. Spanende Fertigungsverfahren:
Mein erster Praxisauftrag war die Bearbeitung eines U-Profils aus Stahl an dem ich verschiedene Spanende Fertigungsverfahren üben sollte. Hierzu bekam ich vom Ausbilder eine technische Zeichnung, an der deutlich wurde was ich am Werkstück zu erledigen hatte. Demnach sollte als erstes das U-Profil auf gesamter länge eben, winklig und parallel gefeilt werden
Beim Feilen handelt es sich um ein Spanendes Fertigungsverfahren mit wiederholter meist geradliniger Schnittbewegung. Die Feile besteht aus einem gehärteten Feilenblatt, der geschmiedeten (ungehärteten) Angel und dem Feilenheft aus Holz oder Kunststoff. Das freie Ende der Feile bezeichnet man als Kopf. (Siehe Abb. 1)
Das Feilenblatt besitzt eine Vielzahl dicht hinher- und nebeneinanderliegender geometrisch bestimmter Schneidzähne. Die linienförmige Anordnung der Einkerbungen auf dem Feilenblatt wird als Hieb bezeichnet. Damit die Späne abfließen können, verläuft der Hieb schräg oder bogenförmig zur Feilenachse. Nach der Hiebart unterscheidet man Einhieb, Kreuzhieb, Raspelhieb und gefräste Feile. Es gibt Feilen in den unterschiedlichsten Auführungvarianten, die sich in der Größe, der Rauhigkeit (Hieb 1, 2, 3), der Hiebanordnung (wie oben schon erwähnt) oder dem Queerschnitt (siehe Abb.2) unterscheiden. Die Auswahl der richtigen Feile hängt hierbei von der Art der auszuführenden Tätigkeit und dem Werkstoff ab. Zur bearbeitung (z.B. Schruppen) eines weichen Werkstoffes (z.B. Alu) wählt man eine Feile mit großem Hieb und großer Hiebteilung (=Anzahl der Hiebe pro Bezugslänge) sowie kleiner Hiebnummer. Bei harten Werkstoffen widerrum greift man zu Feilen mit feinem Hieb und Hiebteilung sowie großer Hiebnummer.
Mir wurde schnell klar, während ich mein Werkstück bearbeitete, das Feilen eine anstrengende, aber sehr lehrreichte Tätigkeit ist. Sie gehört unter anderem zu den ersten Übungen die angehende Auszubildene absolvieren müssen.
Um das Werkstück auf das geforderte Maß zu kürzen benutzte ich eine Bügelsäge für Metall.Ich erstellte also der Planskizze zufolge (siehe anhang) per Höhenanreißer und Anreißplatte (Arbeitsfläche die genau im Lot steht und besonders beschichtet ist) eine geeignete Kennzeichung auf meinem Werkstück, um dies um die richtige Länge zu kürzen. Damit das Sägen leichter fällt, sollte man zum einem das Werkstück sinnvoll und fest so in den Schraubstock einspannen, dass man beim Sägen genug Platz hat und die mittels Höhenreißer gemachten Markierungen klar und deutlich sehen kann. Desweiteren ist zu beachten dass das zu bearbeitende Werkstücke nahe der Schnittstelle eingespannt wird, um die entstehenden Kräfte beim Sägen möglichst gering zu halten.
Für harte Werkstoffe werden Sägeblätter mit einer hohen Anzahl an Zähnen ausgewählt, bei weicheren Werkstoffen widerrum werden Sägeblätter mit weniger Zähnen gewählt. Beim Sägen erwärmen sich die Säge und das Werkstück durch Reibung und wäre der Sägespalt genauso breit wie das Sägeblatt, so würde die Säge nach kurzer Zeit durch die Wärmeausdehnung und die dazu kommenden Späne festsitzen. Deshalb ist es von großer Bedeutung das sich die Säge frei schneiden kann, um nicht hängen zu bleiben. Man schränkt, wellt oder staucht die Sägeschneidkeile, so daß der Sägeschnitt breiter ausfällt als die Dicke des Sägeblatts (sieht Abb.3 Geschränkte Sägezähne). Desweiteren müssen die Späne aus der Schnittfuge transportiert werden, da dies ebenfalls früher oder später zu einem festklemmen des Sägeblattes führen würde, dies geschieht durch den Spanraum der sich zwischen den Sägezähnen befindet (auch Zahnlücke genannt, siehe Abb.4).
Als nächste Aufgabe war das Bohren, Senken, Reiben und Gewindeschneiden an der Reihe, wobei es sich ebenfalls um spanende Fertigungsverfahren von Werkstoffen handelt, hier jedoch die spanende Formgebung durch Werkzeugmaschinen erzeugt wird. Dabei bewegen sich das eingesetzte Werkzeug und das Werkstück gegeneinander und erzeugen so die Zerspanungsarbeit.
Durch Bohren werden zylindrische Löcher hergestellt, was als Vollbohren bezeichnet wird, oder erweitert, was als Aubohren bekannt ist. Als Werkzeug zum Bohren dient in der Metallwerkstatt vorwiegend der Spiralbohrer, welcher aus einem Schneidteil und einem Schaft zur Aufnahme des Werkzeuges besteht. Zwei Spiralförmige Nuten sorgen für die Spanabfuhr und heißen daher „Spannuten“ (siehe Abb.5). Spiralbohrer werden aus niedriglegierten Werkzeugstählen (SS =Schnellschnittstahl) oder hochlegierten Werkzeugstählen (HSS=Hochleistungs-Schnellschnittstahl) hergestellt. Die Härte und Verschleißfestigkeit kann desweiteren durch verschiedene Beschichtungen z.B.aus TiAlN (Titanaluminiumnitrid - violette Färbung), TiCN (Titancarbonitrid - braunschwarze Färbung) oder TiN(Tiannitrid- goldene Färbung) erhöht werden. Beschichtete Bohrer zeichnen sich zudem durch eine hohe Korrosionsbeständigkeit, einer hohen Lebensdauer und deutlich erhöhten Vorschub- und Schnittgeschwindigkeiten aus.
Da ich an meinem Werkstück ein M8 Gewinde herstellen sollte, konnte ich anhand eines Tabellenbuches festellen das ich einen Bohrer mit 6,8mm Durchmesser brauchte um im nachhinhein noch das Gewinde schneiden zu können. Vor dem Bohren ist es wichtig die zu bohrenden Löcher ebenfalls wieder anzureißen (oder vorzukörnen), damit der Bohrer an der erforderlichen Stelle bohrt und nich abrutscht. Das einspannen in einen Schraubstock ist ebenfalls nicht zu vernachlässigen, um das Werkstück während des bohrens vor einem Herumreißen zu sichern. Anhand einer Tabelle auf der Maschine ist es möglich für die jeweilige Bohrergröße die erfoderliche Vortriebsgeschwindigkeit abzulesen (in meinem fall 20m/min). Als Faustregel kann man allerdings sagen je größer der Bohrerdurchmesser, desto kleiner muss die Drehzahl sein. Um die Standzeit der Bohrer zu verlängern wird die Borhstelle während des Bohrvorgangs mit Kühlschmierstoff behandelt.
Manche Löcher (siehe technische Zeichnung) sollten noch auf verschiedene Weise eine Nachbearbeitung erfahren, z.B. mit einer Kegeligen Profilsenkung versehen werden (siehe Abb. 5). Eine Profilsenkung dient dazu den Kopf einer Schraube in einem Bohrloch verschwinden zu lassen, damit dieser nicht über der Oberfläche des Werkstückes herraussteht und bündig mit ihr abschließt. Senken ist ebenfalls ein Bohrverfahren, womit man senkreckt zur Drehachse des Bohrers Profil- oder Kegelflächen erzeugt.
Nachfolgend fuhr ich mit der Gewindeherstellung von Hand fort. Gewindeschneider für Innengewinde bezeichnet man auch als Gewindebohrer (Abb. 6). Sie kennzeichnen sich durch ein Schneidgewinde am vorderen Ende und haben an ihrem hinteren Ende häufig einen Außenvierkant, an dem ein Windeisen befestigt wird, damit die Möglichkeit beim Gewindeschneiden ein größeres Drehmomente zu erzeugen.
Bevor man mit dem Schneiden des Gewindes beginnt, muss man aufpassen das die Gewindebohrer senkrecht in das Bohrloch eingesetzt werden, da es sonst leicht dazu kommen kann, dass die dünnen Vorschneider beim drehen in das Bohrloch abbrechen, was mir beim ersten versuch passierte. Desweiteren wird das Gewinde beim schief ansetzen nicht geradlinig erstellt. Um ein reibungsloses schneiden der Gewinde zu gewährleisten gab ich während des Schneidevorgangs immer wieder ein paar tropfen Öl auf den Schneider und in das Bohrloch. Als ich mit dem Vorschneider das gesamte Bohrloch durchgedreht hatte, vollendete ich das Gewinde mittels einem etwas dickeren Mittelschneider und anschließend dem Fertigschneider.
Das Reiben ist das dritte Bohrverfahren welches ich kennen und anwenden lernte. Es unterscheidet sich von den bisherig beschriebenen Bohrverfahren vor allem durch das eingesetzte Schneidewerkzeug, der sogenannten Reibahle (Abb. 7). Die Bohrungen erhalten durch diese Feinbearbeitung kleine Maß- und Formtoleranzen und eine hohe Oberflächegüte. Die Spanabnahme beim Reiben geschieht wie beim Bohren durch die drehende Schnittbewegung und die axiale Vorschubbewegung des werkzeuges. Da beim Reiben ein Aufbohren der bereits erstellten Bohrungen mit geringer Spannungsdicke erreicht werden soll, ist die Vortriebsgeschwindigkeit sehr klein zu wählen (5m/min). Nach dem säubern der Löcher begann ich mit der Verstiftung. Mit einem Kunststoffhammer schlug ich die Metallstifte zunächst durch die Schienen und dann durch den U-Stahl. Durch das vorherige Reiben musste ich kaum Kraft aufwenden um die Stifte einzuschlagen. Der Vorteil einer Stiftverbindung im Gegensatz zu einer Schraubverbindung liegt vor allem darin, dass sich nun die Schienen immer wieder abmontieren und anschließend wieder passgenau auf den U-Stahl montieren lassen. Bei einer Schraubverbindung ist dieses, wie ich selber merken musste nicht mehr möglich. Abschließend setzte ich den Schieber in die Führung, der sich fast ohne jedes Spiel hin und her bewegen ließ, womit die Arbeiten am U-Stahl abgeschlossen waren.
In der letzten Woche der Spanenden Fertigungsverfahren lernte ich noch das Drehen und Fräsen kennen. Mit dem Drehverfahren werden vowiegend Rundteile (zylindrische Rohlinge) bearbeitet und ruch die Spanabnahme verändert. Das Drehen wird an der sogenannten Drehbank durchgeführt. Sie ist in den meisten Fällen folgendermaßen aufgebaut:
Auf einer Seite ist ein Elektrischer Motor, an dessen Ausgangswelle ein sogenanntes Spannfutter angebracht ist. Dort wird das Werkstück eingespannt und erfährt durch die Verbindung zum Motor eine, in der Geschwindigkeit regelbare, Rotation. Je nach Länge des Wekstücks kann man es auf der gegenüberliegenden Seite der Drehmaschine auch noch in den Reitstock ein spannen, wodurch man eine zweite Lagerung für das Drehteil erhält und so Unwuchten vorbeugt, die sich negativ auf die Genauigkeit auswirken würden (Abb.8).
Zum Bearbeiten des Werkstücks gibt es natürlich auch Werkzeuge, sogenannte Drehmeißel. Sie werden mit einem Werkzeugschlitten parallel zur Rotationsachse des Werkstücks mit der jeweiligen Schnitttiefe und mit einstellbaren Vorschub verfahren. Dieser Drehmeißel besteht aus Hochleistungsschnellarbeitsstahl, Hartmetall oder Keramik.
An einer handgesteuertenDrehmaschine wird dies alles mit Stellrädern bewegt, an der CNC (Computer Numeric Control) aber erfolgt dieser komplette Vorgang, nachdem man eines, in der entsprechenden Programmiersprache geschriebenes Programm, in den Computer der Drehmaschine eingespeist hat, in dem Vorschub, Schnitttiefe, Drehgeschwindigkeit und die Kontur des Drehteils enthalten sind, automatisch. Dabei gibt es, anders als beim Fräsen, nur ein 2-Dimensionales Koordinatensystem, einmal in Längsrichtung entlang der Rotationsachse und der Durchmesser, weil Drehteile folglich auch immer Punktsymmetrisch zur Mittelachse sind.
Die Konturen können dabei nicht nur gerade Formen haben, sie können auch schräg oder rund nach innen und außen sein. Bei runden Konturen muss man einen Mittelpunkt für den Teilkreis in der kontur angeben, sowie den End- und Anfangspunkt, damit der Computer den Drehverlauf später errechnen kann.
Drehmaschinen sind in der Regel sehr schwer, damit die durch den Motor hervorgerufenen Schwingungen nicht die ganze Drehmaschine erschüttern können. Die einzelnen Bauteile sind sehr robust geabaut, wodurch sie sich in keinster verformen können, was ebenfalls auf die Kosten der Genauigkeit gehen würde.
Wie oben schon beschrieben gibt es einige verschiedene Auführungsvarianten an Drehmeißeln, die jeweils auf verschiedene Aufgaben ausgelegt sind. Beim Drehen beginnt man zunächst mit dem Schruppen, wobei dicke Späne vom Werkstück abgenommen werden, um recht schnell an den gewünschten Durchmesser heranzukommen, die Genauigkeit is daher noch recht grob.
Wenn dieser Vorgang des Schruppens beendet ist, folgt das Schlichten. Dabei wird bei geringerer Schnittgeschwindigkeit und hoher Drehzahl ein feiner Span am Werkstück abgenommen, wodurch eine hohe Genauigkeit erreicht wird. Deutlich sichtbar wird dieser Unterschied zwischen Schruppen und Schlichten durch die Rillen die nach dem Schruppen auf dem Werkstück enstanden sind, die jedoch durch das Schlichten fast verschwinden.
Die Bearbeitung des Wekstücks ist nicht nur von außen möglich, sondern auch von innen. Dazu bohrt man zunächst genau auf der Rotationsachse ein Loch in das Werkstück und dreht dann mit einem Innendrehmeißel die gewünschte Kontur in das Werkstück.
Eine weitere Bearbeitungsart beim Drehen ist das Plandrehen, wobei einfach nur am freien Ende des Wekrstücks ein Stück abgeschnitten wird und das Ende dadurch eben, also „plan“ gemacht wird.
Man kann beim Drehen sehr hohe Fertigungsgenauigkeiten erzielen, sowohl beim manuellen als auch beim CNC-gesteuerten Drehen, wobei es beim handgesteuerten Drehen natürlich von den Fähigkeiten des Drehers abhängt.
Nachdem ich mich mit der Drehbank und deren Funktionen vertraut gemacht hatte, bekan ich eine UVV-Belehrung (Unfallverhütungsvorschriften) bei der erstmaligen Bedienung einer neuen Werkzeugmaschine meinerseits. Wichtig hierbei ist, sich vor dem Spanflug mit einer Brille zu schützen. Daraufhin händigte mir der Werkstattmeister zwei technische Zeichnungen aus (siehe Anhang), aus denen deutlich wird welche arbeiten ich an den Stahlrohlingen zu tätigen hatte.
Als erstes stellte ich die benötigte Drehzahl für meine Arbeiten ein und setzte den Drehmeißel auf den Werkzeugschlitten und spannte ihn fest. Das zu bearbeitende Wekrstück (Stahlrohling) spannta ich daraufhin fest in das Dreibackenfutter ein. Dieses sollte mit Sorgfalt durchgeführt werden, da die Drehzahl bei ca. 1200 Umdrehung pro Minute lag und ein herausfliegen des Rohlings oder ein vergessen den Spannschlüssels des Dreibackenfutters zu entfernen, schwere Verletzungen zur Folge hätten.
Zunächst musste ich den Drehmeißel ausrichten, bevor ich beginnen könnte das Werkstück auf die gewünschte Form zu bringen. Hierfür fuhr ich bei laufender Maschine mit dem Werkzeugschlitten in Richtung des Werkstückes vor, bis ich mit dem Meißel den Rohling genau ankratzte (berührte). Daraufhin stellte ich die vorhandene Skala am Drehrad für den Vorschub des Werkzeugschlittens auf Null. Mithilfe dieser Skalierung kann man genau nachvollziehen um wie viele Millimeter man den Meißel bewegt. Die gleiche Prozedur führte ich mit dem Querschlitten durch, und kontrollierte desweiteren ob der Meißel mittig ausgerichtet war. Zur mittigen Ausrichtung des Meißels wird ein Bereich des Werkstückes plangedreht und dann kontrolliert ob noch ein kleiner Zapfen übersteht (Bereich am Werkstück der durch die falsche Ausrichtung des Drehmeißels nicht erreicht werden kann) , falls dies der Fall ist muss der Meißel neu zentriert werden. Ebenfalls war es noch wichtig zu beachten das Werkstück zunächst von einer Seite komplett zu bearbeiten, bevor man den Rohling „umspannt“ um die andere Seite zu bearbeiten, da man sonst den Rohling nie mehr genau in der gleichen Position einspannen könnte und die Genauigkeit dadurch leiden würde.
Nach diesen unerlässlichen Vorarbeiten dreht ich zunächst den Rohling auf die geforderte Länge (100mm) und begann den ersten Kranz (Durchmesser 20mm) auf der linken Seite zu erstellen.
Ich stellte 2mm am Querschlitten und lies den gesamten Schlitten zunächst um 37mm in Längsrichtung nach vorne fahren. Hierbei erfolgte die Spanabnahme am Drehmeißel, der durch das Zusammenwirken von zweier Bewegungen ohne Unterbrechung im Eingriff ist. Das Werkstück führt hierbei eine kreisförmige Schnittbewegung um die Drehachse aus und das Werkzeug eine geradlinige und stetige Vorschubbewegung aus. Die Spandicke wird folglich durch die Zustellbewegung des Werkzeuges bestimmt.
Anschließend nahm ich mit einer Bügelmessschraube das Maß des bearbeiteten Rohlings, welcher nun im Druchmesser ca. 23,09 mm betrug. Daran konnte ich erkennen, dass die Drehbank nicht genau den eigestellten Skalenwert abgetragen hatte. Da die Differenz zwischen Ist-und Sollmaß noch über 3,09mm betrug, konnt ich nochmal 2mm an der Skala des Querschlittens hinzustellen. Mit diesem Wert drehte ich das Werkstück wieder um 37mm in Längrichtung ab und nach erneutem Messen kam ich auf einen Durchmesser von 21,17mm. Um das geforderte Maß von 20mm zu erreichen, sollte ich die restlichen 1,17mm zum Sollmaß in drei Schritten abnehmen. Hierfür teilte ich die 1,17mm durch drei (=0.39mm) und wählte diesen Wert als nächsten Zustellwert der Skala am Querschlitten, nach erneutem abdrehen ergab sich ein Durchmesser von 20,76mm. Die restlichen 0,76mm musste ich nun in zwei gleichgroßen Schritten noch abnehmen (jeweils0,38mm). Die abschließende Messung des Durchmessers ergab 20,04mm, der damit im erlaubten Toleranzbereich lag.
Nach dem Fertigstellen des Durchmessers musste ich nur noch die geforderte Länge des Zapfens erstellen (geforderte 38mm). Mit einem Tiefenmesser überprüfte ich zunächst das maß der Länge (37,02mm) und fuhr anschließend mit dem Drehmeißel um 38mm in Längsrichtung zum Dreibackenfutter vor. Jedoch fuhr ich nach erstellen der 38mm Länge nicht wieder in Längsrichtung zurück, sondern senkrecht zur Drehachse aus dem Rohling haraus, da ich somit eine gerade Plangedrehte Abschlussfläche herstellen konnte. Damit war der erste Zapfen komplett hergestellt.
Die restlichen Zapfen erstellte ich nach dem gleichen Prinzip.
Auch bei meiner zweiten Übungsarbeit (siehe Anhang), ging ich im groben nach dem gleichen Schema vor. Die einzigen Unterschiede lagen in der wesentlich geringeren Toleranzgrenze, sowie darin, dass ich an das Ende des Werkstückes eine Zentrierbohrung setzen musste. In diese wurde beim drehen eine mitlaufende Zentrierspitze eingeführt, die im Reitstock eingespannt wird und ein Umherschwingen des Werkstückes verhindert. Dies war nötig, da nur ein sehr geriger Teil des Rohlings aufgrund seiner zu erstellenden Form in das Dreibackenfutter eingespannt werden konnte.
Somit waren meine Arbeiten an der Drehmaschine abgeschlossen.
Im Gegensatz zum Drehen wird beim Fräsen die notwendige Drehbewegung zur Spanabhebung nicht durch die Drehung des Werkstücks erreicht, sondern durch die Rotation des Fräskopfes. Die weiterhin notwendige Vorschubbewegung wird, je nach Bauart der Fräse, entweder durch verschieben des kompletten Maschinentisches, auf der das zu bearbeitende Werkstück eingespannt ist, oder durch Bewegung des Fräskopfes um das Werkstück herum erreicht.
Genau wie bei der Drehmaschine erfolgt der manuelle Betrieb über Stellräder, die den Tisch (oder den Fräskopf) in X, Y und Z-Richtung verfahren wobei Bedienende dabei selber auf höchstmögliche Genauigkeit zu achten hat. Früher wurden bei großen zu fertigenden Stückzahlen zur Hilfe Schablonen verwendet, nach denen der Frästisch verfahren wurde.
Nach der Lage der Werkzeugachse/Werkstückoberfläche unterscheidet man zwischen zwei Arbeitsweisen des Fräsers. Einmal das Walzfräsen, wobei die Achse des Fräsers parallel zur bearbeitenden Fläche liegt (zur Herstellung von z.B. Zahnrädern oder Keilwellen) und das Stirnfräsen, wobei die Werkzeugachse senkrecht zur Werkstückoberfläche liegt. Abhängig von der Vorschubrichtung kann wiederrum zwischen zwei grundsätzlichen Verfahren unterschieden werden, das Gleichlauf-und Gegenlauffräsen. Beim Gleichlauffräsen ist die Drehrichtung des Fräsers und die Vorschubrichtung des Werkstückes gleichgerichtet (Abb. 9). Der Werkstoff wird an der Stelle des größten Spanquerschnitts angeschnitten. Weil der Fräser versucht das Werkstück in Vorschubrichtung zu reißen, darf die Vorschubeinrichtung kein Spiel haben. Bei diese Fräsverfahren enstehen matte oberflächen, wodurch eine matte Oberfläche entsteht, denn der Span reißt bei Schneidenaustritt ab. Wie in der Abbildung 9 zu sehen ist, wird zu Beginn des Fräsvorgangs viel Material abgenommen und am Ende weniger, es ensteht kommaförmiger Span.
Beim Gegenlauffräsen ist die Drehrichtung des Fräsers und die Vorschubbewegung des Werkstückes entgegengerichtet. Die Schneiden gleiten leicht auf dem Werkstück, bevor sie in die Oberfläche eindringen (Abb. 10). Aufrgund der wachsenden Spandicke ist die Fräsmaschine beim Gegenlauffräsen unterschiedlich belastet und es entstehen Vibrationen. Ebenso ist der Kraftaufwand für die Maschine beim Verrichten der Arbeite langsam zunehmend. Am Anfang ist er recht niedrig, da wenig Material abgetragen werden muss, steigt aber dann und erreicht kurz Schneidenaustritt sein Maximum. Hier ensteht ebenfalls Kommaspan.
Wie auch bei den Drehmaschinen gibt es bei den Fräsen einmal Hand- oder mechanisch gesteuerte Fräsen und CNC-Fräsen.
3. Thermische Füge- und Trennverfahren:
In den beiden Wochen vom 29.08.2005 bis zum 09.09.2005 lag das Hauptaugenmerk auf den Thermischen Füge- und Trennverfahren, wobei ich das MIG/MAG Schweißen das Lichbogenschweißen kennenlernte. Hierbei möchte ich mich besonders auf Lichbogenschweißen konzentrieren, da ich mich in diesen zweo Wochen damit am meisten beschäftigte.
Beim MIG/MAG Schweißen handelt es sich um ein Metallschutzgasschweißen (Abb. 11) mit abschmilzender Elektrode. Bei diesem Verfahren wird durch die Zufuhr bestimnter Gase das Schmelzbad vor den schädlichen Einflüssen der Luft abgeschirmt.
Beim Metall-Inert-Gas-(MIG)-Schweißen werden innerte Gase, vorwiegend Argon, als Schutzgas verwendet. Dieses Edelgas ist zwar teuer, ermöglicht aber gute Schweißverbindungen. Besonders bei mittleren und dicken Blechen werden hohe Schweißleistungen erreicht. Eingesetzt wird das MIG-Verfahren für Edelstähle, NE-und Leichtmetalle.
Beim Metall-Aktiv-Gas-(MAG)-Schweißen werden preisgünstigere Aktivegase, sehr häufig Kohlendioxid (CO2) oder Mischgase eingesetzt. Ansonsten entspricht es in Technik und Anwendung dem MIG Verfahren. Angewandt wird das MAG Schweißen hauptsächlich bei niedrig-und unlegierten Stählen, besonders im Karosseriebau zum Schweißen von dünnen Blechen.
Beim Lichtbogenschweißverfahren (Abb. 12) handelt es sich im Gegensatz zum Metallschutzgasschweißen um ein Schweißen ohne Draht. Die stoffschlüssige und somit untrennbare Verbindung zweier Materialen erhält man hierbei mit Hilfe einer Elektrode und hohen Stromstärken, die sich nach der Elekrodendicke richtet. Auch beim Lichbogenschweißen sind ähnlich wie beim Metallschutzgasschweißen einige Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. So ist die Ausrüstung vergleichbar mit dem Schutzgasschweißen, jedoch benötigt man hierbei anstatt einer dunklen Brille einen Gesichtsschutz um sich vor der entstehenden Strahlung zu und dem starken Funkenflug zu schützen. Beim Schweißvorgange entstehen schädliche UV-A und UV-B Strahlen. Außerdem sollten alle Körperteile abgedeckt werden, denn durch die hohe Temperatur von 4000°C enstehen viele Funken und Schweißperlen, die auf die Haut gelangen könnten. Desweiteren ist aufgrund des hohen Stroms darauf zu achten, das die Arbeitskleidung keine Löcher aufweist, durch welche die Haut in Kontakt mit dem geschlossenen Stromkreis kommen könnte.
Um das Schweißen mit dem Lichtbogenschweißgerät ein bisschen deutlicher zu machen werd ich es wieder an einigen ausgeführten Beispielen vorstellen:
Zwei meiner Aufgaben waren Blindraupen und Kehlnähte in verschiedenen Schweißpositionen herzustellen. Blindraupen sind Schweißnähte die auf ein Werkstück aufgetragen werden, sie verbinden keine Werkstücke miteinander. Mit Blindraupen kann man abgenutztes Material z.B. an einem Werkzeug neu ersetzen ohne es dirket komplett austauschen zu müssen (z.B. Zähne einer Baggerschaufel).
Blindraupen: Kehlnaht:
Zuerst musste ich für die zu bearbeitende Blechdicke (z.B. 2mm) die passenden Stabelektrode wählen (entsprechend 2,5mm im Durchmesser) und in den Stabelektrodenhalter einspannen. Die Stabelektrode hat zum einen die Aufgabe den Schweißzusatzwerkstoff zu liefern und zum anderen schließt sie den Stromkreis zwischen Werkstück und Transformator. Die Polklemme des Transformators wird mit dem Werkstück verbunden. Daraufhin kann ein Lichbogen zwischen Stabelektrode und Werkstück hergestellt werden in dem man mit der Elektrodenspitze das Werkstück berührt wird., hierdurch ensteht vorübergehend ein Kurzschluss. Wird die Elektrode leicht angehoben, ensteht der Lichtbogen, wobei die Luft leitend wird. Dieser erzeugte Lichtbogen liefert eine Wärme von ca. 4000°C, wobei der leitende Stahlkern der Elektrode schmilzt und somit eine Naht bildet. Die Stromstärke richtet sich dabei nach der Stabelektrodendicke, in meinem Fall benutze ich eine Stärke zwischen 50-300A. Erzeugt wird diese Spannung durch den Schweißtransformator, jedoch herrscht dabei nur eine geringe Spannung von ca. 20-40V. Um die Kehlnaht herzustellen ging ich mit der Elektrode im ca. 45°Winkel über das Werkstück. Es ist während des Schweißvorgangs sehr darauf zu achten dass der Abstand zwischen Elektrode und Werkstück dem Elektrodendurchmesser entspricht, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Manche Schweißpositionen jedoch verlangen eine besondere Führung der Elektrode. Zum Beispiel das Schweißen von Blindraupen in der Steigposition. Hierbei baut man die Naht von unten nach oben auf, dabei wird die Elektrode immer leicht von links nach rechts geschwenkt (ca. ein halber Kernstabdurchmesser).
Ich stellte fest, dass die Elektrode sofort abschmolz und die beiden Metallbleche augenblicklich miteinander verbunden hatte. Jedoch musst ich die Elektrode schnell weiter bewegen, um an dieser Stelle die Naht nicht zu dick werden zu lassen. Man sollte versuchen die Elektrode während des Schweißvorgangs so gleichmäßig wie möglich zu führen, um ein möglich gutes Ergebniss zu erzielen.
Der Stahlkern der Elektrode besitzt eine Ummantelung. Diese hat die Aufgabe die Naht vor Sauerstoff zu schützen und legt sich über diese (Schlacke). Desweiteren erleichtert sie den Lichtbogen zu zünden und stabilisiert diesen zusätzlich noch. Ebenfalls verringert sich die Abkühlgeschwindigkeit der Naht durch die Schlacke, somit ist die Gefarh der Rissbildung minimiert. Diese Schlacke wird nach dem erlischen der Rotglut mit einem sogenannten Schlackehammer abgeklopft.
Die meisten Schwierigkeiten beim Schweißen hatte ich aufgrund der sogenannten Blaswirkung. Der Lichtbogen besteht fließenden Elektronen, um ihn bildet sich ein radial- magnetisches Feld (genauso wie bei jedem stromdurchflossenen Leiter). Dieses Feld bewirkt das die Elektronen und somit der Lichtbogen abgelenkt wird. Dieses Verhalten wird Blaswirkung genannt. Ein genaues Schweißen ist bei zu großer Blaswirkung nicht mehr möglich. Die Ablenkung ist stark von der Stellung der Elektrode zur Fließrichtung des Stromes abhängig. Man kann der Blaswirkung durch besondere Neigung der Elektrode oder durch ein Umstellen der Polklemme entgegenwirken. Desweitern ist ein „festkleben“ der Elektrode am Werkstück ebenfalls möglich, was passiert wenn die Elektrode beim Zünden zu lange auf einer Stelle gehalten wird.
Mit dem Lichtbogenschweißverfahren führte ich über die restliche Woche noch verschiedenste Schweißverbindungen aus (z.B. Kehlnaht mit mehreren Lagen, Doppelkehlnaht oder auch I- und V-Nähte beim Sumpfstoß).
4. Umformende Fertigungsverfahren:
In der letzten Woche meines Praktikums (12.09.2005 bis zum 16.09.2005) lernte ich verschiedene Umformende Fertigungsverfahren kennen, wie beispielsweie das Biegen von Blechwinkeln,-Blechtafeln und-Edelstahlrohren sowie das Vernieten von Blechen.
Bei allen Umformverfahren werden die zu erstellenden Werkstücke nur durch plastisches Verformen eines vorhergehenden Ausgangsteils hergestellt, d.h. sie werden in eine andere geometrische Form gebracht. Nach den äußeren Kräften die auf den Werkstoff einwirken, kann man umformende Fertigungsverfahren in verschiedene Gruppen einteilen: Biegeumformen, Zugdruckumformen, Druckumformen, Zugumformen, Schubumformen. Allerdings lag das Hauptaugenmerk meiner letzten Praktikumswoche auf dem Biegeumformen, welches ich nun ein wenig erläutern werde.
Damit ein Werkstück gebogen werden kann, muss die Elastizitätsgrenze des Werkstoffes überschritten werden, damit die Verformung oder Biegung dauerhaft ist, allerdings darf die Bruchgrenze nicht erreicht werden und der Werkstoff muss ausreichen dehnbar sein. Beim Biegen wird ein Teil des Werkstücks auf Zug, das andere auf Druck beansprucht (Abb. 13). Auf der Außenseite werden die Fasern des Werkstoffs gestreckt (verlängert/Zug) und auf der Innenseite gestaucht (verkürzt/Druck).
Das Biegen von Rohren unterscheidet sich, abgesehen von den eingesetzten Hilfsmitteln/Werkzeugen, im Vergleich zu Blechen durch die Verringerung des Rohrquerschnittes. Da beim Biegen hohe Belastungen auftreten, versuchen die Rohrwände an den Stellen wo besonders startke Zug- und Druckspannungen entstehen diesen Belastungen auszuweichen, indem sie sich den neutralen Fasern nähern. Der Grad der Abflachung bei einer Rohrbiegung wird umso größer,
je größer der Rohrdurchmesser
je dünner die Rohrwand
je kleiner der Biegeradius
je geringer die Dehnbarkeit des Werkstoffs
Durch die Abflachung in der Biegezone verringert sich logischerweise auch der Durchflussquerschnit. Somit ist der Einsatz von gebogenen Rohren als Leitung für z.B. Flüssigkeiten sehr unvorteilhalft, auch die Belastbarkeit eines Rohres an der Biegestelle sinkt erheblich.
Um diese bei einer Biegung der Rohre von Hand auftretenden negativen Begleiterscheinung entgegenzuwirken, gibt es zwei nützliche Verfahren um die Beanspruchung der Biegestelle auf ein Minimum zu reduzieren.
Beim ersten Verfahren wird der Hohlraum des Rohres mit einer Füllung versehen, welche das Rohr bei der Biegung stabilisiert (z.B. trockener Sand, leicht schmelzbare Stoffe wie Blei etc.). Für das zweite Verfahren wird eine sogenannte Biegevorrichtung (Abb. 14) benutzt. Der Vorteil hierin liegt das man die Rohre nicht zur Stabilisierung befüllen muss. Die Biegevorrichtung besteht aus mehreren Rollen, die einen bogenförmigen Querschnitt besitzen. Diese Stütz- und Biegerollen können je nach Durchmesser des Rohres ausgetauscht werden und mit passenden Querschnitten, der auf den Rohrdurchmesser abgestimmt ist, erstetzt werden. Dadurch wird das Rohr beim Biegevorgang durch die Rollen gestützt, wodurch eine ungewollte Verringerung des Querschnitts und ein Einknicken vermieden werden kann.
Als letztes Umformendes Fertigungsverfahren lernte ich das vernieten von Bauteilen kennen, welches ich hier kurz näher beschreiben werde. Durch das Nieten werden Bauteile unlösbar miteinander verbunden, die Verbindung ist im nachhinein nicht mehr zerstörungsfrei zu lösen. Der große Vorteil des vernietens von Werkstücken gegenüber dem Schrauben liegt darin das keine Gewinde benötigt werden und die Bauteile nur mit Bohrungen versehen werden müssen. Desweiteren wird das Nieten eingesetzt wenn sich die zu verbindenen Teile gar nicht oder nur schwer schweißen lassen oder wenn die durch Wärme enstehende Spannungen im Bauteil unerwünscht sind. Die Niete selber besteht aus einem sogenannten Setzkopf und einem zylindrischen Schaft. Der Schließkopf wird durch Umformen (Hammerschlag etc.) der überstehenden Schaftlänge gebildet.
Nieten werden nach der Form des Nietkopfes und ihrer Aufgabe unterschieden, die wohl bekannteste ist die Blindniete (Abb. 15). Sie werden verwendet wenn das Nietloch nur von einer Seite zugänglich ist (z.B. Fahrzeug- und Flugzeugbau ).
5. Montagen auf diversen Baustellen:
Desöfteren hatte ich während meines Praktikums die Möglichkeit mit einigen Handwerkern Montagearbeiten auf Baustellen auszuführen. Dazu gehörten unter anderem das einbauen/anbringen von Fensteranlagen, Brandschutztüren, Fensterbänken sowie Verkleidungsarbeiten an der Fassade. An dieser Stelle werde ich ein paar Fotos, der jetzt fertig umgebauten Volksbank Reken, einbringen an denen die verrichteten Arbeiten recht deutlich werden. Die Firma Meinert & Seifert übernahm in dieser groß angelegten Umbau Aktion die kompletten Verglasungsarbeiten (inklusive Brandschutztüren) und die Verkleidungsarbeiten an der Außenfassade.