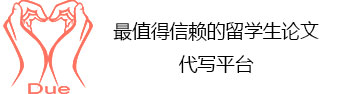服务承诺
 资金托管
资金托管
 原创保证
原创保证
 实力保障
实力保障
 24小时客服
24小时客服
 使命必达
使命必达
51Due提供Essay,Paper,Report,Assignment等学科作业的代写与辅导,同时涵盖Personal Statement,转学申请等留学文书代写。
 51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标 51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标 51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标 51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标私人订制你的未来职场 世界名企,高端行业岗位等 在新的起点上实现更高水平的发展
 积累工作经验
积累工作经验 多元化文化交流
多元化文化交流 专业实操技能
专业实操技能 建立人际资源圈
建立人际资源圈Bergier
2013-11-13 来源: 类别: 更多范文
Die Debatte der 90er Jahre um die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Hat sich das Geschichtsbewusstsein der Schweizerinnen und Schweizer grundlegend verändert'
1.1: Einführungs- und Theoriemodul
Kritischer Essay eingereicht an der Universität Zürich, Historisches Seminar
Master of Advanced Studies in Applied History
Christian Bandy, Student
Jan-Friedrich Missfelder, Dozent
Die Arbeit ist nicht vertraulich.
Bern, 20. Juni 2010
Inhaltsverzeichnis
1 These 3
2 Kriterien und Vorgehensweise 3
2.1 Kriterien für grundlegende Veränderung des Geschichtsbewusstseins 3
2.2 Vorgehensweise 3
3 Situationsanalyse zur Aufarbeitung der Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg 4
3.1 Aufarbeitung von 1945 bis 1995 4
3.2 Aufarbeitung ab 1995 5
3.3 Fokusthemen 7
3.3.1 Kritik und Krise 7
3.3.2 Negative materielle Konsequenzen 8
3.3.3 Auslöser und Beteiligte der Debatte 8
3.3.4 Unabhängige Expertenkommission (UEK) 9
4 Prüfung der These 10
4.1 Indizien für und wider die These: 10
4.1.1 Vorhandensein von wesentlicher Kritik 10
4.1.2 Vorhandensein von „Geist der Krise“ mit materiellen Konsequenzen 10
4.1.3 Relevantes Thema beschäftigt öffentliche Meinung und die Politiker 10
4.1.4 Vorhandensein „Bedürfnis nach Selbstreinigung“ 11
4.2 Fazit 11
5 Verzeichnisse 12
5.1 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen 12
5.2 Elektronische Medien 13
5.3 Abkürzungsverzeichnis 13
These
Die Debatte der 90er Jahre um die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg (nachrichtenlose Vermögen, Nazi-Gold, Bergier-Bericht, etc.) hat das Geschichtsbewusstsein der Schweizerinnen und Schweizer grundlegend verändert.
Kriterien und Vorgehensweise
In diesem Essay werden folgende Kriterien verwendet.
1 Kriterien für grundlegende Veränderung des Geschichtsbewusstseins
Das Geschichtsbewusstsein beinhaltet grundsätzlich Zeit-, Wirklichkeits-, historisches, Identitäts-, politisches-, ökonomisch-soziales und moralisches Bewusstsein[1]. In diesem Essay wird nicht auf die verschiedenen Ausprägungen des Begriffs „Geschichtsbewusstsein“ eingegangen, sondern betrachtet das generelle Geschichtsbewusstsein der Schweizerinnen und Schweizer im Kontext der Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Für die Zwecke dieses Essays wird eine teilweise Anlehnung an den Begriff der „programmatischen Zeitgeschichte“[2] vorgenommen. Diese „sucht die Auseinandersetzung mit einer in die Gegenwart heranreichenden Vergangenheit“[3]. Als Kriterien für eine grundlegende Veränderung des Geschichtsbewusstseins wurden folgende Aspekte gewählt:
▪ Vorhandensein von wesentlicher Kritik;
▪ Vorhandensein von „Geist der Krise“ mit materiellen Konsequenzen;
▪ Relevantes Thema beschäftigt öffentliche Meinung und die Politiker;
▪ Vorhandensein „Bedürfnis nach Selbstreinigung“.
2 Vorgehensweise
Nach der Beschreibung der Aufarbeitung der Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg von 1945 bis 1995 (siehe Kap. 3.1) folgt eine Übersicht über die wichtigsten Ereignisse ab 1995 (siehe Kap. 3.2). Anschliessend werden vier Themen vertieft behandelt: Kritik und Krise, negative materielle Konsequenzen, Auslöser und Beteiligte sowie die Unabhängige Expertenkommission (siehe Kap. 3.3). Schliesslich soll die These anhand der gewählten Kriterien geprüft werden (siehe Kap. 4).
Situationsanalyse zur Aufarbeitung der Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg
1 Aufarbeitung von 1945 bis 1995
Die Schweiz wurde im 20. Jahrhundert durch die beiden Weltkriege betroffen, war aber kein eigentlicher Kriegsschauplatz. Dementsprechend führte das Ende des Zweiten Weltkrieges aus Sicht von Bruni nicht zu einem Kontinuitätsbruch:
“Für andere Länder hat das Kriegsende eine Zäsur bedeutet und Umwälzungen gebracht. Doch in der Schweiz blieben die alten Interessen, Mentalitäten und Personen prägend.”[4]
Die Schweiz profitierte während und nach dem Krieg nahtlos von der unversehrten Infrastruktur. Diese ermöglichte der Schweiz unter anderem als Drehscheibe für internationale Finanztransaktionen zu fungieren. Diese Aktivitäten führten bereits kurz nach Kriegsende zu Diskussionen bezüglich der Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg. So vereinbarte die Schweiz 1946 im Rahmen des Abkommens von Washington[5] die Zahlung von CHF 250 Mio. an die Siegermächte als Kompensation für Geschäfte mit den Achsenmächten[6]/[7]. Die zeitliche Nähe zum eben beendigten Weltkrieg verhinderte eine fundierte öffentliche Debatte:
„Über das eigene Verhalten gegenüber den Verfolgten und deren Hab und Gut wurde hingegen wenig nachgedacht. (…) [es] bestand zunächst nur begrenztes Interesse an einer umfassenden Analyse des Umgangs mit jenen Vermögenswerten, die im Zuge des Holocaust entwendet worden waren.“[8]
Zwischen diesem Abkommen und den 90er Jahren wurde die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg unregelmässig thematisiert, beispielsweise anlässlich des Bonjour-Berichts:
„1962 hatte Edgar Bonjour vom durch anhaltende Diskussionen verunsicherten Bundesrat den Auftrag erhalten, die Interdependenz von Aussen- und Innenpolitik in den neuralgischen Jahren zwischen 1939 und 1945 zu untersuchen.“[9]
Grundsätzlich beteiligten sich aber bis zu den 90er Jahren nur wenige Schweizerinnen und Schweizer an der Debatte: „Obwohl das Thema damit nicht einfach von der Bildfläche verschwand, wurde es von der Öffentlichkeit während langer Zeit kaum mehr wahrgenommen.“[10]
2 Aufarbeitung ab 1995
Bis Ende der 80er Jahre herrschte in Europa der Kalte Krieg. Dieser
„verstärkte (…) im Westen die Tendenz zur innenpolitischen Disziplinierung unter Ausgrenzung der radikalen Linken sowie der verschiedenartigsten Dissidenten. Dies wiederum förderte die Bereitschaft, unangenehme Fragen der jüngsten Vergangenheit undiskutiert zu lassen.“[11]
Der Kalte Krieg endete mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Diese Zäsur in der Weltgeschichte gab anderen Themen Platz. In der breiten Öffentlichkeit begann die intensive Debatte über die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg Mitte der 90er Jahre. Zum 50-jährigen Ende des 2. Weltkrieges in Europa entschuldigte sich der damalige Bundespräsident Villiger[12] vor der Vereinigten Bundesversammlung für die Rolle der Schweiz während dem Krieg, insbesondere in Zusammenhang mit der Rückweisung von Flüchtlingen. Einen Monat später publizierte das Wall Street Journal einen kritischen Artikel[13] über nachrichtenlose Bankkonten in der Schweiz. Unter dem Titel „Secret Legacies“ diskutierte Gumbel die Frage, ob sich noch nachrichtenlose Vermögen auf Schweizer Banken befinden. Zudem berichtete er über die Schwierigkeiten der Nachfahren von Opfern des Dritten Reiches an diese Vermögenswerte zu kommen. Inmitten der Negativschlagzeilen erhielt ein anderer Fall besondere Aufmerksamkeit: Die Rehabilitation des St. Galler Hauptmanns Paul Grüninger[14], zeigte die Rolle der Schweiz in einem anderen, positiven Licht. Dennoch rückte nach dem Jahreswechsel 1995/96 die Diskussion bezüglich der nachrichtenlosen Vermögen wieder in den Fokus der Öffentlichkeit. Insbesondere die Tätigkeiten von Senator Alfonse D’Amato[15] sowie von US-Anwalt Ed Fagan[16], welcher einen Teil der Sammelklagen der Opfer des Nationalsozialismus gegen Schweizer Banken übernahm, setzen die Schweiz unter Druck.
„In den Monaten vor der Einsetzung der UEK Ende 1996 hatte sich die Diskussion um die Fragen der Goldtransaktionen zwischen der Schweizerischen Nationalbank und dem nationalsozialistischen Deutschland und um die nachrichtenlosen Vermögen auf Schweizer Banken unerwartet zugespitzt.“[17]
Die offizielle Schweiz reagierte auf die verschiedenen Vorwürfe mit einem Bündel von Massnahmen[18]:
▪ Mai 1996: Abschluss einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) zwischen der Schweizer Bankiervereinigung, dem World Jewish Congress (WJC) und der World Jewish Restitution Organization im Mai 1996. Dieses schuf die Grundlage für das Volcker Committee[19], welches insbesondere nachrichtenlose Bankkonten suchte.
▪ Dezember 1996: Der National- und der Ständerat beschlossen einstimmig die Einsetzung einer unabhängigen Expertenkommission (UEK)[20], welche die Rolle der Schweiz im zweiten Weltkrieg von verschiedenen Blickwinkeln analysieren sollte.
▪ Februar 1997: Etablierung und Finanzierung „Schweizer Fonds zugunsten bedürftiger Opfer von Holocaust/Shoah“ durch Banken, private Unternehmungen und die Schweizer Nationalbank (SNB).
3 Fokusthemen
1 Kritik und Krise
Wie obenstehend beschrieben, war die Schweiz ab Mai 1995 heftiger und regelmässiger Kritik aus dem Ausland, insbesondere aus den Vereinigten Staaten und aus Israel, sowie aus politisch eher linken Kreisen in der Schweiz, ausgesetzt. Diese ging nicht spurlos an der Bevölkerung vorbei. Die Kritik zielte auf das eigentliche „Geschäftsmodell Schweiz“ (Neutralität, Banken, Humanismus). Die Allgemeinheit forderte Lösungen zur Klärung der Kritik. Die Politik konnte aber bis zur Einsetzung der unabhängigen Expertenkommission keinen funktionierenden Befreiungsschlag erreichen. Die Machtlosigkeit führte in weiten Teilen der Bevölkerung zu einem Gefühl der Krise. Dieses Gefühl der Krise betraf auch die Politik. Der damalige Bundespräsident Jean-Pascal Délamuraz kommentierte die Forderungen des WJC nach einem Hilfsfond über Mio. 250 CHF mit der Aussage, dass „dies auf ‚ein Lösegeld und Erpressung’[21] hinauslaufe“. Auch die UEK befindet, dass sich die Schweiz in einer „innen- und aussenpolitischen Krise“[22] befand. Das damalige Gefühl der Krise hat teilweise bis heute gehalten:
„Wenn die Bergier-Kommission unseren Grosseltern schon vorwirft, sie seien zuwenig solidarisch mit den Opfern des Nationalsozialismus gewesen und hätten einen zu tiefen Bückling vor dem ‚Grössten Feldherr aller Zeiten’ im Norden gemacht, dann sollten wir uns um so mehr mit den heutigen Opfern der Kriege auf dem Balkan, in Afghanistan, im Irak und in anderen Ländern solidarisch zeigen und die Taten der ‚einzigen Weltmacht’ als das benennen, was sie sind: kriminell Handlungen und Verletzungen des Völkerrechts.“[23]
2 Negative materielle Konsequenzen
Wie oben (siehe Kapitel 3.1) beschrieben, blieb die Schweiz bis zu den 90er Jahren von wesentlichen materiellen Konsequenzen verschont. Erst der politische, juristische und moralische Druck aus dem In- und Ausland in den 90er Jahren führten zu einer Reihe von finanziellen Vergleichen zwischen Schweizer Grossbanken/Versicherungen und Klägern von Opfern aus dem Dritten Reich. Diese Bankenvergleiche lösten in der Öffentlichkeit heftige Debatten aus. In konservativen Kreisen, beispielsweise bei Angehörigen der Aktivdienstgeneration sowie bei der SVP war von Erpressung und Geschichtsverfälschung die Rede. Parallel dazu revidierten viele Schweizerinnen und Schweizer ihr Ansichten zu der Rolle der Schweiz im 2. Weltkrieg. Das idyllische Bild, welches vom kriegsverhindernden Réduit und der humanitären Seite der Schweiz geprägt war, wurde angepasst und durch eine differenziertere, kritischere Betrachtung ersetzt.
3 Auslöser und Beteiligte der Debatte
Unterschiedliche Meinungen bestehen zum Ursprung der Debatte. Die eher konservativen Kreise sehen den Anstoss im Ausland. Diese Sichtweise wird durch Eizenstat[24] untermauert, welcher als Auslöser den Gumbel-Artikel[25] im Wall Street Journal sowie das verstärkte Interesse des Jüdischen Weltkongresses nennt. Bergier stellt fest, dass die Debatte auf „Druck der Aussenwelt“[26] beschleunigt wurde. Aber er bemerkt weiter: „Viel mehr (…) ist die ‚Rückkehr des Verdrängten’ meiner Meinung nach eine innere Entwicklung, der Ausdruck eines Bedürfnisses nach Klarheit, nach Normalität, nach Entmythologisierung“[27] war. Da die Debatte exogen angestossen wurde, fokussierte sich die öffentliche Meinung auf die als ungerecht interpretierte Kritik und nicht auf die eigentlichen Inhalte. D.h. die inhaltlich-fundierte Debatte beschränkte sich bis 1995 auf einen relativ kleinen Kreis von Intellektuellen, Historikern und Publizisten. Die öffentliche Meinung war hingegen noch nicht bereit für diese Rückkehr in die Vergangenheit[28]. Ab 1995 fanden intensive Diskussionen über die Rolle der Schweiz und deren Bevölkerung während dem 2. Weltkrieg statt. Diese Debatten fanden nicht nur Spezialistenkreisen statt, sondern beschäftigen die Politik und durch die extensive Berichterstattung in den Medien mehr und mehr auch die breite Öffentlichkeit.
4 Unabhängige Expertenkommission (UEK)
Die UEK wurde 1996 durch die Vereinigte Bundesversammlung eingesetzt (siehe Kap. 3.2). Sie hatte den Auftrag, die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg zu untersuchen. Dabei ging es insbesondere um Flüchtlingspolitik, Aussenwirtschaft und Vermögenstransaktionen. Die Zusammensetzung und Finanzierung erfolgten über die Eidgenossenschaft. Aufgrund dieser Konstellation kam es zu Vorwürfen, dass die Historiker aufgrund der Abhängigkeit zu den Geldgebern nicht die „Wahrheit“, sondern eine historisch-gewünschte Staatswahrheit konstruieren würden:
„Obwohl die Kommission ‚unabhängig’ genannt wurde, war sie dies keineswegs. Im Gegenteil – sie war in jeder Beziehung abhängig von den Bundesbehörden. […] Wissenschaftlern, die tatsächlich unabhängig waren, wurde der Zugang zu den Daten und Dokumenten verwehrt, […].“[29]
Ab 1997 wurden laufend Forschungsergebnisse der UEK veröffentlicht. Der Schlussbericht lag im März 2002 vor. Darin wird, eingebettet in den historischen Kontext, insbesondere das Versagen der Entscheidungsträger während und nach dem Zweiten Weltkrieg bezüglich Flüchtlingspolitik, Kooperation mit der Kriegswirtschaft der Achsenmächte sowie die Restitutionspolitik nach dem Krieg kritisiert[30].
Prüfung der These
1 Indizien für und wider die These:
Basierend auf den Kriterien (siehe Kap. 2.1) soll geprüft werden, ob sich das Geschichtsbewusstsein der Schweizerinnen und Schweizer durch die Debatte der 90er Jahre um die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg grundlegend verändert hat.
1 Vorhandensein von wesentlicher Kritik
Bis 1995 war m.E. Kritik aus dem In- und Ausland vorhanden. Diese manifestierte sich beispielsweise im Bonjour-Bericht sowie einer Vielzahl von wissenschaftlichen Aufsätzen und Büchern. Aber erst durch die zeitliche Distanz zu den Ereignissen (Zusammenbruch Ostblock sowie 50jähriges Jubiläum des Kriegsendes) und durch den Druck aus den USA sowie vom WJC wurde die Kritik wesentlich.
► Das Kriterium ist eher erfüllt.
2 Vorhandensein von „Geist der Krise“ mit materiellen Konsequenzen
Ein solcher Geist entstand aus meiner Sicht erst durch die erhärtete Kritik ab 1995. Mit Ausnahme der Zahlungen im Rahmen der Washingtoner Abkommen war die Schweiz vorher nicht von wesentlichen finanziellen Konsequenzen betroffen. Im Kontext mit der massiven Kritik ab 1995 und dem dadurch entstandenen „Geist der Krise„ sah sich die Schweiz zu Befreiungsschlägen gezwungen. Dieser beinhaltete zwei wesentliche Aspekte: Die Einsetzung der UEK und der Bankenvergleich. Durch letzteren entstanden erstmals seit 50 Jahren signifikante materielle Konsequenzen. Die beiden Massnahmen konnten aber den „Geist der Krise“ nur kurzfristig lindern.
► Das Kriterium ist eher erfüllt.
3 Relevantes Thema beschäftigt öffentliche Meinung und die Politiker
Die Kritik aus dem Ausland stiess m.E. bei einer Mehrzahl der Schweizerinnen und Schweizern auf Unverständnis. Das historische Selbstbild geriet ins Wanken. Das Thema beschäftigte die Öffentlichkeit aber in zwei höchst unterschiedlichen Ausprägungen. Die eher konservativen Kreise (SVP, Aktivdienstgeneration, Stammtisch) sahen sich eher als Opfer einer internationalen Hetzkampagne. Sie kritisierten vornehmlich die Angreifer, d.h. den WJC, die linken Politiker in der Schweiz sowie die U.S.A. Am anderen Ende des Meinungsspektrums wurden die Vorwürfe ernst genommen. Viele sahen sich in ihren Vermutungen bestätigt und beschäftigten sich intensiv mit dem Thema.
► Das Kriterium ist nur teilweise erfüllt.
4 Vorhandensein „Bedürfnis nach Selbstreinigung“
Das Bedürfnis nach Läuterung war in gewissen Kreisen der Bevölkerung und der Politik gross. Als Instrumente standen Entschuldigungen, Abbitte in Form des Bergier-Berichts sowie Opferentschädigungen zur Auswahl. Dieses Bedürfnis betraf aber nur eine Minderheit der Öffentlichkeit.
► Das Kriterium ist nur teilweise erfüllt.
2 Schlussfazit
Zwar wurde die Schweiz hart kritisiert und durchlebte dadurch eine Krise mit realen Konsequenzen. Aber die Öffentlichkeit und die Politiker beschäftigen weniger mit der Aufarbeitung der Geschichte, sondern vielmehr mit der Rolle der Kritiker (pauschal U.S.A. und „die Juden“). Dementsprechend war das Bedürfnis zur Selbstreinigung nur bei einer Minderheit der Schweizerinnen und Schweizer vorhanden. Die anfänglich stipulierte These ist meines Erachtens falsch. Die Debatte der 90er Jahre um die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg hat das Geschichtsbewusstsein der Schweizerinnen und Schweizer nicht grundlegend verändert.
Verzeichnisse
1 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen
Barben Judith: Spin doctors im Bundeshaus, Gefährdungen der direkten Demokratie durch Manipulation und Propaganda, Eikos Verlag, Baden 2009
Bergier Jean-François: Einladung zur weiterführenden Diskussion, in: Neue Zürcher Zeitung, 01.06.2002
Brüggemann Gerd: Die Schweiz war nicht unmoralisch, in: Neue Zürcher Zeitung, 24.03.2002
Castelmur, von Linus: Schweizerisch-alliierte Finanzbeziehungen im Übergang vom Zweiten Weltkrieg zum Kalten Krieg. Die Deutschen Guthaben in der Schweiz zwischen Zwangsliquidierung und Freigabe (1945-1952), Chronos, Zürich 1992.
Codevilla Angelo: Die Schweiz in Bedrängnis, Die Schweiz im Zweiten Weltkrieg und moralischer Druck heute, Novalis, Schaffhausen 2002
Dean Martin: Robbing the Jews, The Confiscation of Jewish Property in the Holocaust, 1933-1945, Cambridge University Press, New York, 2008
Dipper Christof: Die Geburt der Zeitgeschichte aus dem Geist der Krise, in: Nützenadel Alexander und Schieder Wolfgang (Hg.): Zeitgeschichte als Problem. Nationale Traditionen und Perspektiven der Forschung in Europa. Geschichte und Gesellschaft. Zeitschrift für Historische Sozialwissenschaft, Göttingen, 2004
Engel Anja: Die Schweiz und ihr Neutralitätsstatus während des Zweiten Weltkrieges. Ihre Diskrepanz zwischen monetären und sozialen Interessen, Grin Verlag, Norderstedt, Deutschland, 2010
fre (Kürzel): Bergier-Komission sieht sich „am Ziel“, in: Neue Zürcher Zeitung, 23.03.2002
Gumbel Peter: Secret Legacies, in: The Wall Street Journal, 21.06.1995
Kreis Georg: Die schweizerische Flüchtlingspolitik der Jahre 1933-45, in: Kreis Georg, Müller Bertrand (Hg.): Die Schweiz und der Zweite Weltkrieg, Schweizerische Zeitschrift für Geschichte, 47/4, Basel 1997
Lebow Richard: The Politics of Memory in Postwar Europe, Duke University Press, Durham, USA, 2006
Maissen Thomas: Was motivierte die Nationalbank beim (Raub-)Goldhandel', in: revue suisse d’histoire, 1999/4
Meier Thomas: Bergier-Bericht widerlegt. In: Schweizer Zeit, 25/2000
Pandel Hans-Jürgen: Dimensionen des Geschichtsbewusstseins, Ein Versuch, seine Struktur für Empirie und Pragmatik diskutierbar zu machen.
In: Geschichtsdidaktik 12, 1987, H. 2
tmn (Kürzel): Ein Meilenstein' In: Neue Zürcher Zeitung, 23.03.2002
Unabhängige Untersuchungskommission Schweiz (UEK): Die Schweiz, der Nationalsozialismus und der Zweite Weltkrieg, Schlussbericht, Pendo Verlag, Zürich, 2002.
Vanoni Bruno: Am Ende der Sackgasse. In: Tages-Anzeiger, 30.11.2001.
2 Elektronische Medien
www.uek.ch: Unabhängige Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg
www.ess.uwe.ac.uk: University of West England, School for Humanities, Languages and Social Sciences
www.hls-dhs-dss.ch: Historisches Lexikon der Schweiz
www.jewishvirtuallibrary.org: Online-Bibliothek des American-Israeli Cooperative Enterprise
www.shoah.de: Informationsportal zu den Themen Holocaust, Shoah, Drittes Reich und Zweiter Weltkrieg
Schweiz aktuell: Schweizer Fernsehen, Lokalnachrichten
www.welt.de: Deutsche Tageszeitung
3 Abkürzungsverzeichnis
UEK Unabhängige Expertenkommission
WJC World Jewish Congress
-----------------------
[1] Hans Jürgen Pandel: Dimensionen des Geschichtsbewusstseins. Ein Versuch, seine Struktur für Empirie und Pragmatik diskutierbar zu machen. In: Geschichtsdidaktik 12, 1987, H. 2, S.130-142
[2] Christof Dipper: Die Geburt der Zeitgeschichte aus dem Geist der Krise, in: Alexander Nützenadel und Wolfgang Schieder (Hg.): Zeitgeschichte als Problem. Nationale Traditionen und Perspektiven der Forschung in Europa. Geschichte und Gesellschaft. Zeitschrift für Historische Sozialwissenschaft, Göttingen, 2004, S. 152-156.
[3] Christof Dipper: Die Geburt der Zeitgeschichte aus dem Geist der Krise, S. 152.
[4] Vanoni Bruni, Am Ende der Sackgasse, Tages-Anzeiger, 30.11.2001.
[5] Linus von Castelmur, Schweizerisch-alliierte Finanzbeziehungen im Übergang vom Zweiten Weltkrieg zum Kalten Krieg. Die deutschen Guthaben in der Schweiz zwischen Zwangsliquidierung und Freigabe (1945-1952), Zürich, 1992, Seite 421 ff
[6] Interessanterweise wurde dieses Abkommen in der Schweiz auch als „amerikanische Erpressung“ tituliert. Siehe tmn (Kürzel): Ein Meilenstein, Neue Zürcher Zeitung, 23.03.2002
[7] Aus Sicht der UEK interpretierte aber die Schweizer Verhandlungsdelegation in Washington diese Zahlung aber „nicht als Restitution, sondern als freiwilligen Beitrag zum Wiederaufbau des zerstörten Europas.“ Unabhängige Expertenkommission (UEK): Die Schweiz, der Nationalsozialsozialismus und der Zweite Weltkrieg, Schlussbericht. Pendo, Zürich 2002. S. 99.
[8] UEK, Schlussbericht, S. 19.
[9] Jakob Tanner. Die Schweiz hatte wieder einmal Glück. Edgar Bonjours Geschichtsschreibung. In: NZZ Folio, 08.1991. [Stand: 08.06.2010].
[10] UEK, Schlussbericht, S. 517.
[11] UEK, Schlussbericht, S. 96.
[12] Kaspar Villiger: Rede an die Vereinigte Bundesversammlung, 07.05.1995, Bern, Schweiz
[13] Peter Gumbel: Secret Legacies. In: The Wall Street Journal, 21.06.1995, USA
[14] Schweiz aktuell: Der Fall Paul Grüninger, Schweiz 27.11.1995, Schweizer Fernsehen
[15] Der Senator Alfonse D’Amato leitete die Anhörungen des Bankenausschusses des U.S. Senats bezüglich der nachrichtenlosen Konti in der Schweiz.
[16] Ed Fagan forderte in den Medien zum Boykott gegen die Schweizer Banken auf. Seine Kritik an der Schweiz gipfelte in der Aussage „Deutschland war in Nürnberg vor Gericht, die Schweiz wird es hier in Brooklyn sein." Ed Fagan. In: Alfred Zänker. Die Welt. Die Holocaust-Gelder oder eine schwierige Wahrheitssuche. 02.01.1997. [Stand: 07.06.2010].
[17] UEK, Schlussbericht, Vorwort.
[18] UEK, Schlussbericht, Vorwort.
[19] Benannt nach dem Vorsitzenden der U.S. Federal Reserve Paul A. Volcker. Das Committee fand 54’000 nachrichtenlose Bankkonten, welche allenfalls Holocaust-Opfern gehörte. Vgl. Investigators Find Thousands Of Unacclaimed Swiss Bank Accounts, 06.12.1999. [Stand: 09.06.2010]
[20] fre (Kürzel): Bergier-Kommission sieht sich „am Ziel“, Neue Zürcher Zeitung, 22.03.2002
[21] Jean-Pascal Délamuraz: In: Alfred Zänker. Die Welt. Die Holocaust-Gelder oder eine schwierige Wahrheitssuche. 02.01.1997. [Stand: 07.06.2010].
[43] UEK, Schlussbericht, Vorwort.
[44] Judith Barben: Spin doctors im Bundeshaus, Gefährdungen der direkten Demokratie durch Manipulation und Propaganda. Eikos, Baden 2009. S. 121ff.
[45] Vgl. Gerd Brüggemann. Interview mit Eizenstat, Die Schweiz war nicht unmoralisch, Neue Zürcher Zeitung, 24.03.2002
[46] Gumbel, Secret Legacies.
[47] Bergier, Einladung zur weiterführenden Diskussion.
[48] Bergier, Einladung zur weiterführenden Diskussion.
[49] Vgl. Jean-François Bergier, Einladung zur weiterführenden Diskussion, Neue Zürcher Zeitung, 01.06.2002
[50] Barben, Spin doctors im Bundeshaus, S. 112.
[51] Vgl. Jean-François Bergier, Einladung zur weiterführenden Diskussion, Neue Zürcher Zeitung, 01.06.2002